Computerspiele im Geschichtsunterricht 18. Februar 2009
Posted by pe2pe in Schulischen Kontexte.Tags: Bildung, Bildungspotential, Computerspiele im Unterricht, Forschung, Kompetenzen, Lernen, Literatur, Potenziale, Spiele im Unterricht
trackback
 Mit dem Gegenstand Geschichte am Computer beschäftigen sich zwei Bände der Reihe Methoden Historischen Lernens. Der zweite Band „Computerspiele im Geschichtsunterricht“ von Waldemar Grosch ist für unser Feld exemplarisch. Es ist eines der wenigen Werke auf dem Markt, das explizit nach Möglichkeiten sucht, Computerspiele in den Unterricht einzubeziehen.
Mit dem Gegenstand Geschichte am Computer beschäftigen sich zwei Bände der Reihe Methoden Historischen Lernens. Der zweite Band „Computerspiele im Geschichtsunterricht“ von Waldemar Grosch ist für unser Feld exemplarisch. Es ist eines der wenigen Werke auf dem Markt, das explizit nach Möglichkeiten sucht, Computerspiele in den Unterricht einzubeziehen.
Wie schon in einem früheren Beitrag versprochen vertiefe ich nun den Inhalt und stelle im Folgenden den Aufbau des Buches vor und werde beispielhaft ein Spiel und seinen Einsatz in der Schule erläutern.
In den ersten beiden Kapiteln werden die Vorraussetzungen für den Einsatz von Computerspielen im Unterricht allgemein geklärt. Probleme wie Hardwarekapazität, räumliche Gegebenheiten und Spielstandspeicherung werden thematisiert und als echte Stolpersteine entlarvt. Gerade diese Bedingungen, die unumgängliche Vorrausetzungen darstellen, schrecken schnell vom Einsatz von Computerspielen ab.
Die Einordnung von Computerspielen in Genres (nach Fehr/Fritz) rundet die Einleitung ab, ohne jedoch konkrete Vorschläge für den Unterricht zu geben.
Im dritten Kapitel macht sich Grosch Gedanken zu pädagogischen Aspekten von Spielen im Allgemeinen. Spiele sind einerseits „flexible Vorbereitung auf das Erwachsenendasein“[1] und „Grundlage kultureller Tätigkeiten“[2]. Zum Thema Spiele ist die wissenschaftliche Betrachtung schon bedeutend weiter fortgeschritten. Nach den von Hans Scheuerl definierten Kriterien gehören Computerspiele zu den Spielen:
„Auch am Computer wird freiwillig gespielt, die Abgrenzung zur Realität ist schon durch die technischen Gegebenheiten offensichtlich (und dies wird von Kritikern ja auch hervorgehoben); Computerspiele sind üblicherweise unproduktiv, und ihnen liegt ein Regelsystem zugrunde.“[3]
Vor allem die Komplexität von Computerspielen führt Grosch als besonders motivierend an.
Das vierte Kapitel stellt Chancen und Risiken von Computerspielen gegenüber. Gefahren, Jugendschutz, Ästhetik und pädagogische Aspekte werden näher erläutert. Besonders interessant ist hierbei die Erkenntnis,
„dass sich die Entwicklung in der Welt der Computerspiel unter Ausschluss von Pädagogik und Schule vollzogen [hat]. Nur eine Minderheit von Lehrerinnen und Lehrer hat konkrete Vorstellungen davon, was Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit am Computer tun und einüben. Ähnlich wie beim Fernsehen, wo sich pädagogische Institutionen inzwischen fast völlig von an Einschaltquoten orientierten Geschäftsleuten und Medienhandwerkern haben verdrängen lassen, erfolgt eine aktive Mitgestaltung oder Einflussnahme an der Entwicklung von Computerprogrammen kaum und speziell an Spielen überhaupt nicht.“[4]
Und das obwohl Spiele und eben auch Computerspiele die Lebenswirklichkeit der Schüler darstellen und sie so am stärksten zu motivieren sind.
Für die konkrete Unterrichtswirklichkeit wird es vor allem ab dem fünften Kapitel interessant, in dem sich Grosch mit der Geschichte im Computerspiel befasst. Hier gibt es verschieden Möglichkeiten. Spiele können als Quelle dienen (alte Atarispiele repräsentieren den technischen Entwicklungsstand der damaligen Zeit), Abbilder von Geschichte sein, als Erklärungshilfen dienen oder virtuelle Geschichte darstellen. Die historische Wahrhaftigkeit steht aber bei Computerspielen häufig im Hintergrund.
„Die Grenze zwischen frei erfundenen und quellenmäßig belegbaren Elementen ist erst bei gründlicher Analyse erkennbar. Historisch gesicherte Aussagen, Interpretationen und phantasievolle Ausschmückungen sind vermischt und für den Laien nicht zu trennen. Für den Geschichtsunterricht ergibt sich daraus die zwingende Forderung, die Fähigkeit zur Differenzierung zu vermitteln und zu verdeutlichen, dass im Computerspiel allenfalls ein Teil der Wirklichkeit abgebildet wird.“[5]
Als Unterrichtsgegenstand ist das Themenfeld Reflektion über Geschichte vorgeschrieben. In diese Themenfeld kann man historische Computerspiele verankern.
In den folgenden Kapiteln stellt Grosch zunächst allgemeine Überlegungen zu Computerspielen im Geschichtsunterricht an, um dann konkrete Spiele-Beispiele zu liefern. Dafür möchte ich nun ein exemplarisches Spiel darstellen.
Commandos – Hinter feindlichen Linien 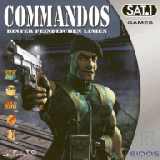
Zunächst stellt Grosch kurz den Aufbau des Spiels und die Spielidee vor (in diesem Spiel ist diese, als Einsatzleiter eines Kommandotrupps im Zweiten Weltkrieg einzelne Sabotageakte durchzuführen) um danach einige Aspekte zur Technik des Spiels zu nennen. Die spielerische Qualität ist der dritte Betrachtungspunkt, bevor Grosch die pädagogische Bewertung vornimmt. Bei Commandos problematisiert er vor allem die Individualität jeder einzelnen Spielfigur, die durch eine fiktive Biografie Identifikationsmöglichkeiten stiftet, und der Anonymität der handelnden Spielfiguren, die relativ unerkennbar auf dem Bildschirm agieren. Außerdem verstoßen einzelne Figuren gegen geltendes Völkerrecht indem sie feindliche Uniformen tragen können und Gift als Tötungsmittel zum Einsatz bringen. Genauso kritisch betrachtet er das gewalttätige Spielprinzip (eine gewaltfreie oder friedliche Lösung jeder Aufgabe ist völlig ausgeschlossen und die Darstellung ist nur für den deutschen Markt zensiert – ansonsten spritzt das Blut, schreien verletzte Gegner und liegen Leichen herum  ), das nicht umgangen werden kann, von den Spielern jedoch meist als unumgänglich, weil eben realistisch wahrgenommen wird.
), das nicht umgangen werden kann, von den Spielern jedoch meist als unumgänglich, weil eben realistisch wahrgenommen wird.
Die historische Dimension stellt den fünften Punkt dar. Grosch stellt hier die britischen Commandos vor, die in historischer Dimension eher einfachen Elitesoldaten entspricht. Übereinstimmungen liegen vor allem in technologischem Bereich vor.
Methodische Vorschläge beschließen die Vorstellung des Spiels. Grosch rät von einem Einsatz im Unterricht zwar ab, schlägt aber sechs verschiedene Ansätze vor:
- Einen Vergleich zwischen Einsätzen der historischen Commandos und der Darstellung im Spiel, wobei Quellen zum Einsatz kommen sollten.
- Die Kritik am Feindbild und dem Hollywoodklischee vom stupiden Deutschen.
- Die Problematisierung de im Spiel erforderlichen Kampfweise.
- Die Diskussion über die entschärfte Fassung für den deutschen Markt.
- Die Untersuchung ausgewählter, scheinbar historisch korrekter Details und der Vergleich mit den Fakten.
- Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob die (akzeptable) Spielidee durch die (inakzeptable) Gewaltdarstellung entwertet wird.
Das Buch ist eine Hommage an den Einsatz von Computerspielen im Unterricht. Grosch verfällt allerdings nicht der Illusion, dass man alle Spiele im Unterricht spielen sollte, er plädiert vielmehr für eine Behandlung der Thematik und eine Aufklärung im pädagogischen Sinne. Allen Risiken zum Trotz sollten Computerspiele genauso Teil der Unterrichtswirklichkeit werden, wie es Spielfilme längst sind. Dem technologischen Fortschritt sollte man sich nicht verschließen, sondern in ihn lenkend und fördernd eingreifen.
ist es für ein buch mit dem titel „computerspiele im geschichtsunterricht“ nicht sehr fraglich bei fünf einzelbeispielen drei spiele zu wählen die erst ab 16 oder 18 jahren freigegeben sind? eins davon „secrets of the luftwaffe“ steht sogar auf dem index, die vorgängerversion von panzergeneral 3d steht auch darauf. wenn kein schüler eine klasse übersprungen hat, kann man als lehrer das buch in der 13. klasse verwenden, so ein käse! wenn man als autor gegen die verwendung von computerspielen im geschichtsunterricht ist, sollte man dies in den titel oder die einleitung schreiben, aber nicht durch eine unsinnige auswahl von spielen implizieren. herr grosch sollte mal lieber essays von kurt squire oder jürgen fritz lesen und parallel ein bisschen civilisation spielen, um auch bei kommerziellen spielen auf jugendfreie ideen zu kommen.
wenn ich seite 185 lese denke ich mir, dass das thema verfehlt ist: „mittelalter: ultima 9 / rollenspiel in einer fantastischen mittelalterlichen welt / eines der besten spiele seiner art!“ da kann er in einer neuauflage „world of warcraft“ gleich auch noch als computerspiel für den geschichtsunterricht nominieren. peinlich ist das!